DENKMALSCHUTZ
Warum Denkmalschutz?
Der Denkmalschutz ist eine besondere Art des Umganges mit unserer Geschichte. Denkmale sind „footprints“ der Menschheit und Zeugnisse ihrer kulturellen Leistungsfähigkeit. Sie sind identitätsstiftend und Ausdruck der Epoche, in der sie entstanden, und geben regelmäßig den Zustand der intellektuellen und handwerklichen Fähigkeiten, aber ebenso den der Gefühlswelt wieder. In ihnen widerspiegelt sich der Zustand von Stammesgemeinschaften, aber auch von Völkern. Baugeschichte und Denkmale sind zugleich auch immer Ausdruck des „Lebensgefühls“ und des „Zeitgeistes“. Sie repräsentieren die Geschichte eines Landes und einer Stadt.
Denkmalschutz ist deshalb eine Angelegenheit von außerordentlicher Bedeutung und immer auch von öffentlichem Interesse. Denkmalschutz bedarf des Herzens und des Verstandes! Und er ist eine sehr wichtige und verantwortungsvolle Angelegenheit, die nach einer dauerhaften Fürsprache verlangt!
Die Assyrer bauten nahezu alle Gebäude mit Lehmziegeln und Holz als Deckentragwerke, die alten Ägypter zunächst ebenso, später dann aus Stein, wie wir noch heute an den Pyramiden ablesen können. Die Griechen (gerade auch in Vorderasien. Hierzu zählt auch der berühmte „Tunnel des Eupalinos“, der im 6. Jahrhundert v.Chr. die Wasserversorgung der griechischen Stadt Samos sicherstellte. Eine unglaubliche Ingenieurleistung) und Römer waren wahre Baumeister, wobei die Römer in späterer Zeit den Mauerziegel als Basismaterial nahmen. Gott sei Dank kannten sie noch keinen Beton im heutigen Sinne, sonst hätten wir keinerlei Baudenkmale aus der Zeit!
Nach dem Denkmalschutzgesetz Baden-Württemberg ist es die Aufgabe des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, Kulturdenkmale zu schützen und zu pflegen. Dazu gehört auch, den Zustand der Kulturdenkmale zu überwachen und Gefahren für ihren Bestand abzuwehren. Die Beseitigung oder Veränderung von Kulturdenkmalen steht deshalb ausdrücklich unter einem denkmalrechtlichen Genehmigungsvorbehalt.
Was ein Denkmal ist, wird im „Gesetz zum Schutz der Kultur-denkmale (Denkmalschutzgesetz – DSchG) in der Fassung vom 6. Dezember 1983 (zuletzt geändert durch Gesetz zur Änderung des Denkmalschutzgesetzes Vom 9. Dezember 2014) legal definiert.
Das Denkmalschutzgesetz Baden-Württemberg unterscheidet zwischen so genannten einfachen Kulturdenkmalen nach § 2 DSchG, die in Listen erfasst werden, und zwischen Kulturdenkmalen von besonderer Bedeutung nach § 12 DSchG, die im Denkmalbuch eingetragen werden. Die Feststellung der Denkmaleigenschaft erfolgt nach den drei Kriterien wissenschaftlich, künstlerisch und heimatgeschichtlich bedeutsam. Eine Besonderheit des Denkmalschutzgesetzes Baden- Württemberg ist das deklaratorische Prinzip, das heißt, ein Gebäude kann, auch wenn es nicht in der Liste erfasst ist, ein Denkmal sein.

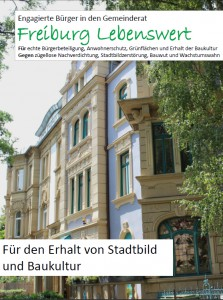
Unter Denkmalschutz: Die Gartenstadt in Freiburg Haslach.
Der Denkmalschutz betrifft einzelne Gebäude ebenso wie ganze Ensemble oder gar Stadtteile mit ihrem historischen Erscheinungsbild. Denkmalpflege ist kein einfaches Geschäft, sie verlangt einerseits viel Einfühlungsvermögen, andererseits zielorientiertes Handeln: nämlich was soll bewirkt werden? Und sie sollte immer neben dem öffentlichen Interesse auch das Interesse des Nutzers in ausreichendem Maße berücksichtigen. So wurde beispielsweise in der Nähe von Rottweil ein unter Denkmalschutz stehender Schafstall in enger Zusammenarbeit von Denkmalamt, Baurechtsbehörde und Nutzer so umgebaut, dass er nach Umbau sogar Aufenthaltsräume für behinderte Jugendliche ermöglichte. Ähnliches geschah mit einem Bauvorhaben der Staatsanwaltschaft in der Freiburger Kaiser-Joseph-Straße. Aus denkmalschutzrechtlichen Gründen sollte die Fassade zur Straße hin dreigeschossig erhalten bleiben, zugleich aber das erweiterte Raumprogramm der Staatsanwaltschaft möglich gemacht werden: Ergebnis hinter der dreigeschossigen Fassade befindet sich im hinteren Teil ein fünfgeschossiges Gebäude. Auch dies war nur möglich über eine enge, zielorientierte Zusammenarbeit aller Beteiligter.
Nun gibt es auch im Denkmalschutz Denkrichtungen. Zum einen die sehr dogmatische der Erhaltung und wenn es denn eine Ruine wird, dann die pragmatischere, die nach Sinn und Zweck einer Regelung fragt, und dann die von vielen Denkmalschützern äußerst kritisch beäugte Zunft der Rekonstruktion dem Zerfall anheim gegebener Denkmale.
Die Ruine des Heidelberger Schlosses gehört zur ersten Sorte (dogmatisch), die Umnutzung des Schafstalles in Rottweil mit im inneren erforderlichen Umbauten zur zweiten Sorte(pragmatisch) und die Rekonstrukteure der Semperoper in Dresden zur Dritten (Rekonstruktion mit Originalbaustoffen). Hier kann man auch den Wiederaufbau des Teatro La Fenice (Venedig), das nach der Brandstiftung von 1996 wieder weitgehend originalgetreu errichtet wurde! Ergänzend dazu sei auf die von Polen mit unglaublich handwerklichem Geschick und Herzensblut rekonstruierte früheren deutsche Städte, aber auch Warschaus hingewiesen. In Freiburg könnte man auch an die Konvikt- und Herrenstraße denken, derentwegen wohl viel Touristen die Stadt so schön finden.
Deshalb: der Denkmalschutz hat viele Facetten, die auch von der gerade herrschenden Meinung abhängen.
Konservieren statt Rekonstruieren – so heute das Landesamt für Denkmalpflege – um 1900 wurde der Streit um den Wiederaufbau des Heidelberger Schlosses, eines der bekanntesten Kulturdenkmale Baden-Württembergs, zum markanten Wendepunkt in der Denkmalpflege. Die vornehmlich einem gefälligen Äußeren verpflichtete schöpferische Denkmalpflege des 19. Jahrhunderts wich dem modernen konservatorischen Auftrag: Substanz erhalten – Erscheinungsbild bewahren. Dieses neue Leitbild der Denkmalpflege gilt bis heute.
Vielleicht sollte man aber doch die alten Überlegungen, nämlich eine vornehmlich einem gefälligen Äußeren verpflichtete schöpferische Denkmalpflege (des 19. Jahrhunderts), nicht ganz aus den Augen und den Sinn verlieren. Sie könnten in vielen Fällen eine hilfreiche Brücke darstellen. Und Brücken verbinden!
Die rechtlichen Rahmenbedingungen:
Denkmalschutz ist eine besondere Art der Geschichtswahrung. Nämlich der Baugeschichte. Interessanterweise zählt die Baugeschichte seit Beginn der Architektenausbildung an den Technischen Universitäten zu deren Gründungsfächern in Deutschland. Baugeschichte ist die Geschichte des Siedlungs- und Städtebaus ebenso wie die Geschichte von Bauwerken aller Art: des Hochbaus ebenso wie des Tiefbaus, aber auch der Infrastruktur wie beispielsweise Straßenbau, Versorgungsleitungen im Bereich des Wasserbaus, was zu allen Zeiten eine große Kunst war und ist.
Der moderne Denkmalschutz dient sowohl dem Schutz von Kultur- als auch Naturdenkmalen und ist in den Denkmalschutzgesetzen der Länder geregelt, die in Deutschland für die Kulturhoheit zuständig sind. In Artikel 14 Grundgesetz (GG)wird das Recht auf Eigentum gewährleitet, es wird aber durch das Denkmalschutz-gesetz eingeschränkt. Dies hat besondere Folgen.
In Baden-Württemberg gilt das Gesetz zum Schutz der Kulturdenkmale (Denkmalschutzgesetz – DSchG) in der Fassung vom 6. Dezember 1983, geändert durch Gesetz vom 9. Dezember 2014 (GBl. S. 686).
Danach sind Kulturdenkmale im Sinne dieses Gesetzes Sachen, Sachgesamtheiten und Teile von Sachen, an deren Erhaltung aus wissenschaftlichen, künstlerischen oder heimatgeschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse besteht. Zu einem Kulturdenkmal gehört auch das Zubehör, soweit es mit der Hauptsache eine Einheit von Denkmalwert bildet. Gegenstand des Denkmalschutzes sind auch die Umgebung eines Kulturdenkmals, soweit sie für dessen Erscheinungsbild von erheblicher Bedeutung ist, sowie Gesamtanlagen.

Das Kulturdenkmal „Reinhold-Schneider-Haus“ in der Mercystraße im Stadtteil Wiehre. Gefährdet durch einen modernen, kastenförmigen Anbau und zwei geplante Neubaten in dem – ebenfalls ausdrücklich denkmalgeschützten – Park hinter dem Haus.
Zuständig sind die Denkmalschutzbehörden, die in Baden-Württemberg einen dreigliedrigen Aufbau haben:
Denkmalschutzbehörden sind
1. das Finanz- und Wirtschaftsministerium als oberste Denkmalschutzbehörde,
2. die Regierungspräsidien als höhere Denkmalschutzbehörden (Regierungspräsidium Freiburg Abteilung 2 , Referat 21: Raumordnung, Baurecht, Denkmalschutz),
3. die unteren Baurechtsbehörden als untere Denkmalschutzbehörden,
4. das Landesamt für Denkmalpflege (Das Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart ist zuständige Behörde für die fachliche Denkmalspflege),
5. das Landesarchiv als Landesoberbehörde für den Denkmalschutz im Archivwesen.
Ergänzend dazu gibt es noch einen Denkmalrat, der bei der obersten Denkmalschutzbehörde angesiedelt ist. Er kann aus bis zu 40 Personen bestehen.
Der Begriff „Kulturdenkmal“ ist ein unbestimmter Rechtsbegriff. Was ein Kulturdenkmal ist entscheidet sich jeweils im Einzelfall. Die fachliche Beurteilung obliegt dem Landesamt für Denkmalpflege, das beim Regierungspräsidium Stuttgart angesiedelt ist (Abteilung 8 – Landesamt für Denkmalpflege; Dort ist das Referat 83 innerhalb der Abteilung 8 zuständig für den konservatorischen Umgang mit Bau- und Kunstdenkmalen. Damit ist es Ansprechpartner für alle grundsätzlichen Fragen zur Bau- / Kunstdenkmalpflege in Baden-Württemberg).
Es kümmert sich insbesondere um Kulturdenkmale von überregionaler und nationaler Bedeutung sowie um Welterbestätten im Land. Darüber hinaus berät es auch in allen anderen Fällen von besonderer Bedeutung. Besonders spezialisierte MitarbeiterInnen stehen in drei Fachbereichen zur Verfügung. Das Denkmalverständnis – so das Landesamt – schließt heute in zunehmender Differenzierung die gesamte Fülle vielfältigster historischer Hinterlassenschaften mit ein. Dies betrifft gleichermaßen archäologische Bodenzeugnisse wie Bau- und Kunstdenkmale. Heute gilt ein breit gefächerter Denkmalbegriff, der von prähistorischen Zeugnissen bis zu den modernen Beispielen der Architektur sowie der Technik- und Industriegeschichte reicht.
Über die Denkmaleigenschaft einer baulichen Anlage entscheidet die zuständige untere Denkmalschutzbehörde nach Anhörung des Landesamtes für Denkmalschutz. Will die untere Denkmalschutz-behörde von der Äußerung des Landesamtes für Denkmalpflege abweichen, so hat sie dies der höheren Denkmalschutzbehörde unter Angabe von Gründen mitzuteilen. So kann es beispielsweise sein, dass die untere Denkmalschutzbehörde die Denkmaleigenschaft bejahen will, das Landesamt hingegen nicht. Die höhere Denkmalschutzbehörde prüft innerhalb von zwei Wochen nach Eingang des Schreibens der unteren Denkmalschutzbehörde, ob sie von ihrem Fachaufsichtsrecht Gebrauch macht oder nicht und benachrichtigt davon die untere Denkmalschutzbehörde. Die Entscheidung der höheren Denkmalschutzbehörde erfolgt im Benehmen mit dem Landesamt für Denkmalpflege. Weitere Einzelheiten sind in der „Verwaltungsvorschrift des Finanz-und Wirtschaftsministeriums für das Verfahren zum Vollzug des Denkmalschutzgesetzes für Baden-Württemberg (VwVVollzug DSchG) Vom22. Dezember20l4-Az.: 6-2550.0-1/6- (GABl.vom 28. Januar 2015) enthalten.
Neben den „normalen Denkmalen“ gibt es noch Kulturdenkmale von besonderer Bedeutung. Kulturdenkmale von besonderer Bedeutung genießen zusätzlichen Schutz durch Eintragung in das Denkmalbuch (§12 DSchG).
Unterliegt ein Gebäude dem Denkmalschutz, dann sind bei baulichen Änderungen an solchen Gebäuden neben den baurechtlichen auch die Vorschriften des Denkmalrechtes zu beachten. Neben einer baurechtlichen benötigt man regelmäßig ebenfalls eine denkmalschutzrechtlich Genehmigung, wobei es sein kann, dass die denkmalschutzrechtliche Bestandteil der baurechtlichen sein kann.
Erhält ein Gebäude aufgrund der Entscheidung der unteren Denkmalschutzbehörde die Eigenschaft eines Denkmals, so bedeutet dies regelmäßig einen enteignungsgleichen Eingriff in das Eigentum. Aus diesem Grund genießen solche Gebäude steuerliche Vorteile ebenso wie mögliche Zuschüsse zum Erhalt der baulichen Anlagen. Einzelheiten dazu in der „Verwaltungsvorschrift des Wirtschaftsministeriums für die Gewährung von Zuwendungen zur Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmalen(VwV-Denkmalförderung)Vom 28. November 2019 – Az.: 5-2552.1/9“. Danach gewährt das Land auf Grund des § 6 des Denkmalschutzgesetzes (DSchG) nach Maßgabe dieser Verwaltungsvorschrift, der §§ 23 und 44 Landeshaushaltsordnung (LHO) sowie der Vorschriften hierzu (VV-LHO) und der maßgeblichen Bestimmungen des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG) Zuwendungen zu Maßnahmen, die der Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmalen dienen. Eine Zuwendung kann auf Antrag erhalten der Eigentümer, Besitzer oder sonstige Bauunterhaltungspflichtige eines Kulturdenkmals.
Dr. Dieter Kroll / 12. 05. 2020
