Rede zur Zähringer Höhe

Zur Zähringer Höhe (Drucksache G-24/018 und G-24/019) hat Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler (FL) am 19. März 2023 im Freiburger Gemeinderat folgende Rede gehalten: Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,sehr geehrte Damen und Herren! Es reichen also die in der Umsetzung befindlichen Baugebiete wie Zinklern, Dietenbach, Hinter den Gärten nicht, jetzt muss noch die Zähringer Höhe dem Bauwahn […]
Und nun auch noch der Annaplatz

Bebauung am alten Schulhaus hat begonnen Ein kleines Spiel: Finden wir in Freiburg einen Platz mit historischer Bebauung, der noch völlig unverfälscht und frei von unpassenden Neubauten ist. Im nahegelegenen Colmar kein Problem, auch in Heidelberg, Baden Baden oder Tübingen nicht. Aber in Freiburg? Der Münsterplatz? Nein, da stört doch das Kaufhaus Breuninger ziemlich. Der […]
Zähringer Höhe soll bebaut werden

Ökologisch hochsensibles Gebiet soll Bebauung zum Opfer fallen – Appell von BUND an OB und Gemeinderat Zwölf Jahre nach Beginn der Planungen soll die Bebauung der Höhe Gestalt annehmen. 300 Wohnungen und eine Kita sollen auf dem Gelände entstehen. Die Vorberatung fand am 6.3.2024 im Bauausschuss statt, der Gemeinderat soll die Bebauung am 19.3.2024 beschließen. […]
Anfrage Rotlaubstraße

Zur Rotlaubstraße hat Stadtrat Dr. Wolf-Dieter Winkler (FL) am 24.10.2023 folgende Anfrage (nach § 24 Abs. 4 GemO zu Sachthemen außerhalb von Sitzungen) an OB Martin Horn gerichtet: Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, die auf die Rotlaubstraße treffende Gießenstraße wurde vor einigen Jahren auf Betreiben von Anwohnern zur Spielstraße umgewandelt. Und dies hat sich bewährt, da es […]
Umstrittenes Bauvorhaben in Herdern genehmigt

Bebauungsplanverfahren ohne Einbeziehung des Gemeinderats heimlich still und leise beerdigt Große Bedenken bestanden bereits 2020 nachdem ein Bauherr ein Bauvorhaben für zwei Gebäude mit insgesamt 16 Wohnungen eingereicht hatte. Diese wollte er an einem bewaldeten Hang in der Eichhalde errichten. Die Stadt befand jedoch die geplanten Neubauten „zu massiv“ und aufgrund der Hanglage „im Stadt- […]
Spielwiese und/oder Hundewiese?
Betritt man von der Karlstraße kommend die Grünfläche am sogenannten „Kepler-Park“, befindet sich rechts ein Spielplatz und links, so musste ich mich nach einer entsprechenden Anfrage an die Stadt belehren lassen, eine Hundewiese. Allerdings ist diese Aufteilung nicht erkennbar. Denn die Wiese bietet sich geradezu für Ballspiele der Kinder an. Zudem ist neben ihr eine […]
In der Konradstraße wird nun doch gebaut

Bauträger obsiegt vor dem Verwaltungsgericht – Stadt verzichtet auf Rechtsmittel Niemand in der Wiehre will eine weitere Nachverdichtung mit faden Betonkuben, welche die Natur zerstören und baulich in keiner Weise in diese einzigartige Stadtumgebung passen. Es sei denn, damit lässt sich Geld verdienen. So plant ein Bauherr in zweiter Reihe auf dem parkartigen Grundstück zwischen […]
Ochsenstein-Siedlung in Gefahr

Aus Kreisen der Freiburger Stadtverwaltung ist zu vernehmen, dass im Stadtteil Mooswald wieder einmal die beliebte Geschäftsmethode AuN – Abriss und Neubau mit Nachverdichtung – angewandt werden soll. Diesmal wäre die markante Ochsenstein-Siedlung dran. Wer schonmal den Elefantenweg entlanggelaufen oder -gefahren ist, kennt die runden Dächer der kleinen Häuschen, die zwar wenig modernen Komfort, aber […]
Habsburger Straße 91

Nun ist es passiert. Das seltene historische Gebäude Habsburgerstraße 91 wurde die Tage abgerissen. Wieder einmal hat die Denkmalschutzbehörde einen Abriss genehmigt, obwohl viel dafür gesprochen hätte, dieses Schmuckstück aus der Zeit vor dem gründerzeitlichen Bauboom zu erhalten. Der Investor, der bereits in der Straße das historische Wirtshaus Habsburgerstraße 101 (Amerikahaus) sowie die frühgründerzeitlichen Vorstadtvillen […]
Westbad-Außenbecken, endlich!
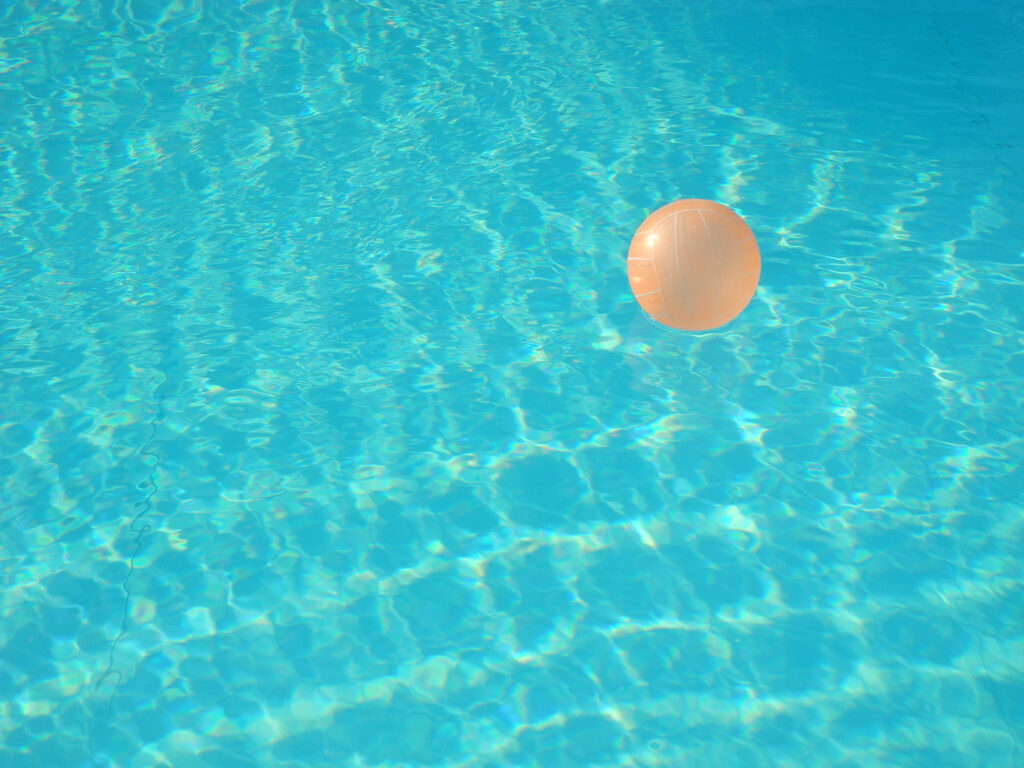
Es gibt drei Immobilien in Freiburg, für die sich FL immer wieder besonders eingesetzt hat. Da wäre zum einen die Forderung nach Sanierung des Westflügels des Lycée Turenne, der seit 30 Jahren den dortigen Schulen trotz derer massiven Raumprobleme vorenthalten wird. Weiter wollen wir den Bau eines klimaneutralen Eisstadions, um die jetzige CO2-Schleuder Echte-Helden-Arena zu […]
